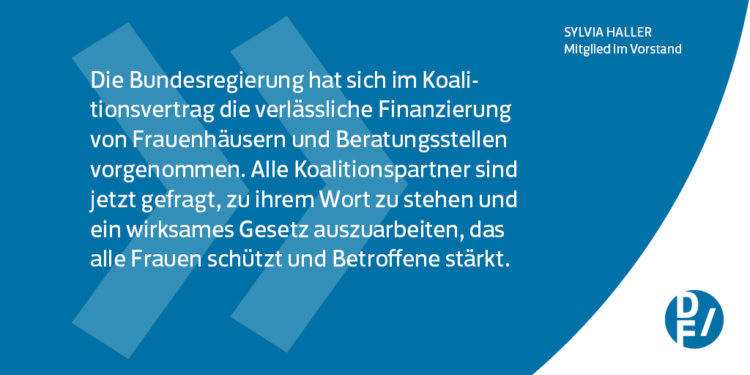Themen / Gewalt gegen Frauen und Mädchen
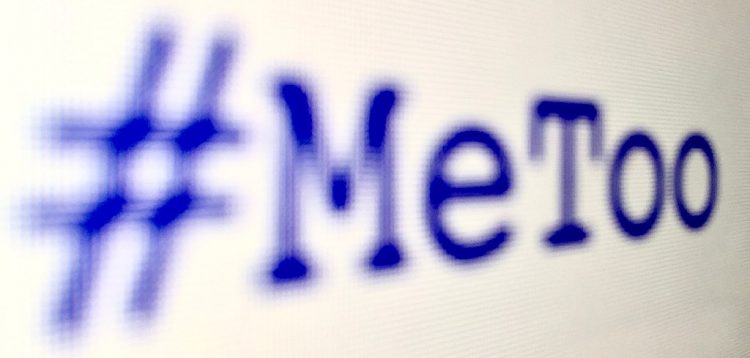
Der Kultur des Schweigens den Boden entziehen – Aufruf zum Internationalen Frauentag 2018
Pressemitteilung | 6. März 2018
Der Kampf für ein Leben ohne (sexualisierte) Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch die zweite Frauenbewegung, die vor rund fünfzig Jahren ihren Anfang nahm. Und bis heute führt dieser Kampf Frauenrechtlerinnen und Feministinnen verschiedener Hintergründe, Überzeugungen und Generationen immer wieder zusammen: sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Vergewaltigung (in der Ehe), sexueller Missbrauch von Kindern, Zwangsprostitution, frauenverachtende Werbung. Diese und andere Gewaltakte an und Erniedrigungen von Frauen wurden in den vergangenen fünfzig Jahren immer wieder aus der gesellschaftlichen Tabuzone ins Licht der Öffentlichkeit geholt.
Aktuell ist es die #MeToo-Debatte, die ausgehend vom Sexismus in der Filmbranche das ganze Spektrum männlichen Machtmissbrauchs vor allem am Arbeitsplatz skandalisiert. Bereits Anfang der Neunzigerjahre war sexuelle Belästigung in Arbeitsverhältnissen in der öffentlichen Debatte. Und „Nein heißt Nein“ hieß schon damals die Parole. Es gab Modellprojekte, Beratungs- und Beschwerdestellen und Verhaltenskodexe. Aber irgendwann verschwand das Thema wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein.
#MeToo und der vor einigen Jahren ebenfalls sehr laute #Aufschrei sind dank der sozialen Medien hoffentlich nachhaltiger. Denn nicht zuletzt #MeToo ist es gelungen, die Debatte mit einer neuen Vehemenz mitten in die Gesellschaft und auf die internationale Bühne zu katapultieren. Sexismus ist in der öffentlichen politischen Debatte angekommen. Kollektive Empörung über den Missbrauch von Machtstrukturen und Positionen, die Reduzierung von Frauen auf Körper ohne Wille und ihre Instrumentalisierung – das ist eine Chance für das Empowerment von Frauen, für einen nachhaltigen Kulturwandel und nicht zuletzt für eine strengere gesellschaftliche Sanktionierung.
„Wir wollen Sexismus bekämpfen“, heißt es im Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition. Gut so. Zu den notwendigen Maßnahmen gehören nicht nur Gesetze, die deutlich die roten Linien für sexualisierte Gewalt ziehen – im Privatleben genauso wie am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum – sondern auch eine konsequentere Strafverfolgung. Ein neuer Nationaler Aktionsplan muss alle Aspekte von sexualisierter Gewalt und Sexismus auf dem Schirm haben. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO erarbeitet aktuell eine neue Konvention, die ArbeitnehmerInnen weltweit besser vor Gewalt und sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz schützen soll. Dieser Abstimmungsprozess muss aktiv unterstützt werden.
Je öffentlicher und selbstbewusster der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und Sexismus geführt wird, desto größer ist die Aufklärung. Und umso mehr Betroffene fühlen sich ermutigt, Zeugnis abzulegen, ihre Scham zu überwinden, über persönliche Kränkungen und Verletzungen zu sprechen. Der öffentliche Diskurs stärkt die Opfer und stellt die Täter ins Abseits. Er entzieht der Kultur des Schweigens den Boden.